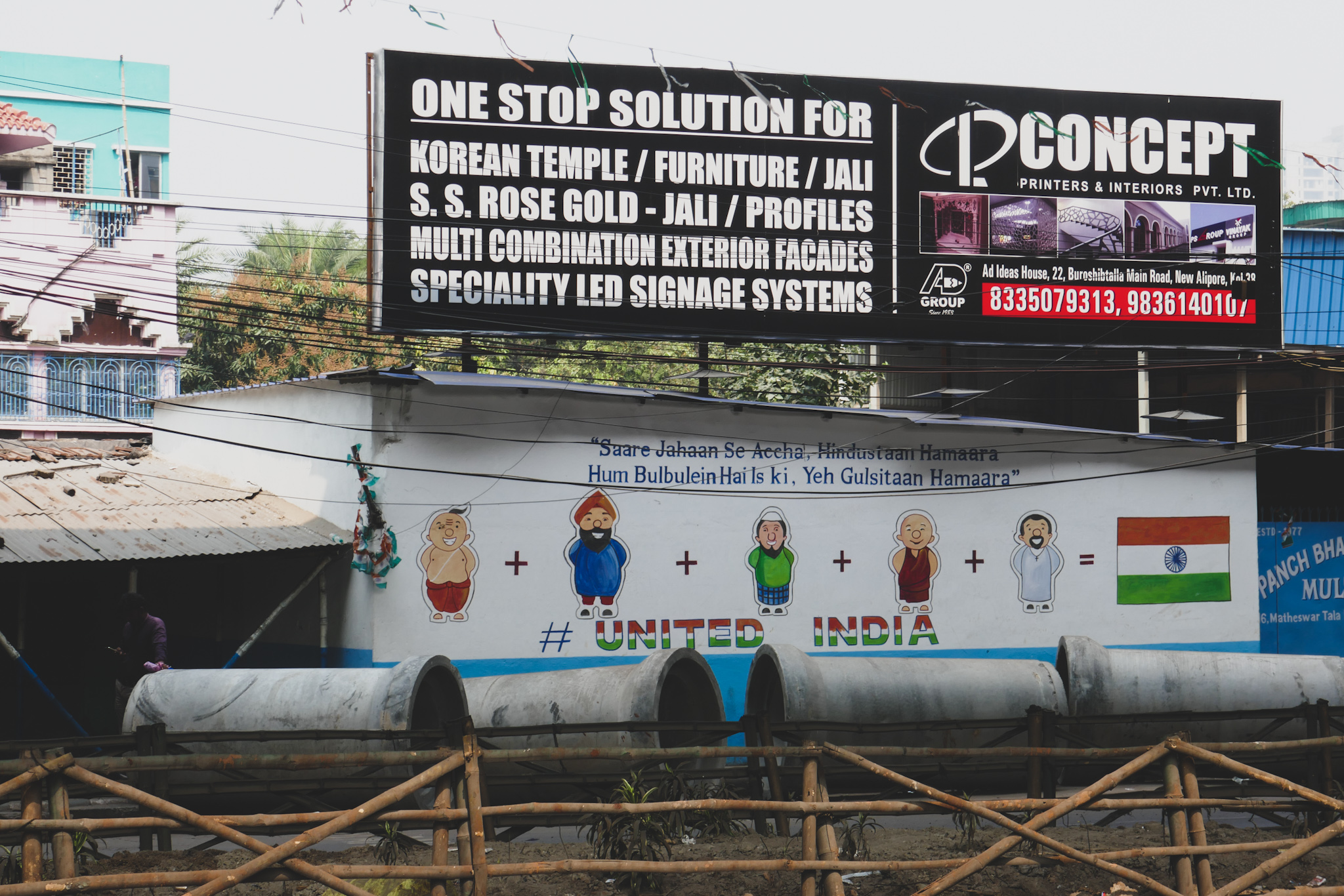Liebe LeserInnen,
um euch vielleicht nicht allzu sehr auf die Folter zu spannen: uns geht’s gut. Vor 5 Tagen sind wir aus einem sich zunehmend isolisierenden Indien nach Thailand ausgeflogen und überlegen uns gerade hier in Bangkok, wie wir weitermachen. Wir müssen uns sortieren, die Lage beobachten, versuchen, ein Stückweit die Zukunft voraus zu sagen und mit dem Gedanken fertig werden, dass das Reisen, so wie wir es uns vorgestellt hatten, auf absehbare Zeit nicht mehr möglich sein wird. Corona sei Dank. Unser Traum von einer Weltreise ohne Flugzeug ist geplatzt, aber noch können wir uns nicht mit dem Gedanken anfreunden, unser Unterfangen komplett abzubrechen. Deshalb haben wir uns entschlossen hier etwas Zeit verstreichen zu lassen und von Tag zu Tag zu schauen, wie sich die Lage entwickelt.
In den letzten 3 bis 4 Wochen hat jedoch nicht nur das Virus unser Leben bestimmt und vielleicht helfen ja auch euch unsere Erzählungen, für einen Moment an schönere Dinge zu denken. Viel Spaß!
–
Als wir Kalkutta den Rücken kehren und die nächste Schlafwagen-Fahrt antreten, denken wir nicht, dass wir so schnell hierher zurückkehren werden. Nach knapp einer Woche haben wir das Gefühl, wir können uns guten Gewissens von ihr verabschieden. Was wir noch nicht wissen, ist, dass wir an Bord eines weiteren Nachtzugs sein werden, der uns gut 3 Wochen später erneut in den hiesigen Bahnhof bringt.
Doch zunächst geht es in den äußersten Norden Indiens, in die Provinz Sikkim. Wir fahren entlang der Grenze zu Bangladesh und kommen am nächsten Morgen in Siliguri, dem Drehkreuz für Weiterfahrten in den Nordosten, Darjeeling oder eben Sikkim, an. Wir verschnaufen einen Tag, aber weil Siliguri nicht viel mehr zu bieten hat als eine teure und zudem noch 2 Stunden entfernte Safari (auf der man immerhin die seltenen einhörnigen Nashörner sehen kann), entschließen wir uns, weiter in den Norden zu fahren.

An der Grenze zum kleinsten Bundesland Indiens, das zwischen Nepal, China und Buthan eingequetscht ist, füllen wir hastig ein Formular aus, das bestätigt, dass wir in letzter Zeit keine Corona-typischen Symptome hatten. Der Bus wartet schon.
Weiter geht es durch saftig grüne Wälder und entlang des Tista-Flusses, der sich majestätisch durch tiefe Täler windet. Gegen Abend kommen wir in der Provinzhauptstadt Gangtok an. Hier auf 1500 Höhenmetern wird es nachts empfindlich frisch, dafür ist es auch die Luft, die wir in den nächsten Tagen atmen. Etwas ab vom Schuss liegt unser Hostel, und so laufen wir viel das hügelige Örtchen hinauf und hinunter. Nicht nur die Menschen hier sehen anders aus als im Rest Indiens (knapp 60% der Bevölkerung sind beispielsweise eingewanderte Nepalesen), auch sonst ist vieles erfrischend neu, so z. B. die Existenz einer Fußgängerzone ohne ohrenbetäubendes Dauerhupen, die natürlich trotzdem nach Gandhi benannt ist, dessen plastisches Abbild beide Enden der Meile schmückt. Zufällig erspäht Henriette ein Plakat, welches ein Filmfestival ankündigt und wir haben Glück: heute laufen die letzten Vorstellungen! Als wir noch eine gute Viertelstunde vom Lichtspieltheater entfernt ist, passiert jedoch etwas Ungewöhnliches: die Himmelsschleusen öffnen sich und entladen eimerweise dichten Regen. Wir sind denkbar unvorbereitet, ist es doch der erste Niederschlag seit Monaten für uns. Trotz des flugs gekauften Regenschirms sind wir nass bis auf die Unterhosen, als wir endlich in die Kinosessel plumpsen. Doch der uns dargebotene Film macht einiges wett: „Gully Boy“ ist eine der größten Produktionen des letzten Jahres und handelt von einem jungen Boy aus einfachen Verhältnissen (gully: Slang für Straße) in Mumbai und seinem Aufstieg zum Rapstar. Das Zuschauen macht großen Spaß, und zwar nicht nur, weil im Soundtrack gekonnt Bollywood-Elemente mit modernen Beats vermischt werden. Der Held der Geschichte ist Muslim und schafft es in klassischer Hip-Hop-Manier über etablierte Klassengrenzen hinweg vom No- zum Somebody. Am Ende wird Gully Boy bei seiner Rückkehr in seine alte Nachbarschaft frenetisch bejubelt, von Hindus und Moslems gleichermaßen.
Nach den anstrengenden Diskussionen mit zweien unserer Couchsurferinnen ist dieser Film trotz seiner dramaturgischen Einfachheit Balsam für die Seele und zeigt, dass die Kulturschaffenden auch hierzulande mehr Weitsicht zu haben scheinen als die Regierung, die sich mit Angstschürerei Wähler verschafft.

Drei Tage später fahren wir in das kleine Dörfchen Pedong, direkt an der Grenze zum Königreich Buthan, welches auch ein reizvolles Land und das einzige mit einer negativen CO2-Bilanz sein soll. Allerdings sind die Einreisebestimmungen für Touristen streng und mit derartigen Gebühren verbunden, dass ein Sich-Kennenlernen erstmal nicht zustande kommt. Stattdessen lassen wir uns auch in Pedong von reichlich Regenfällen begießen und erkunden zwischendurch die Umgebung. Das gleich um die Ecke liegende buddhistische Kloster wird im Moment nur von einem jungen Mönch bewohnt. Der Rest der über 100 Mann starken Bruderschaft sei derweil auf Pilgerreise nach Dharamsala, einer Kleinstadt im Nordwesten Indiens, wo der Dalai Lama seit über 50 Jahren im Exil lebt, erzählt er uns. Wir dürfen die Meditationshalle der Anlage besichtigen, wo die 3 lebensgroßen Buddhas der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft hinter einer Glasscheibe milde auf uns hinunterlächeln.
In einem Gebäude etwas den Hügel hinauf befindet sich die prunkvoll verzierte Stupa, in welcher die sterblichen Überreste der 9. Reinkarnation einer der Gründer des Klosters aufbewahrt werden. Die aktuelle Reinkarnation ist gerade einmal 9 Jahre alt.


Nach einigen eher ruhigen Tagen in der frischen Bergluft wollen wir weiter in den Nordosten Indiens ziehen. Von Siliguri geht es nach Guwahati, der Hauptstadt Assams. Das Holi-Festival steht an. Als wir noch überlegen, es uns in Barpeta, einer 2 Stunden entfernten Stadt, wo Hindus das Fest in noch sehr traditioneller Art und Weise begehen, anzusehen, hören wir, dass es aufgrund des Corona-Virus wohl Beschränkungen bei der Anreise geben wird. Doch die Leute hier wirken gelassen. In Indien gäbe es noch unter 100 bestätigte Fälle von Infizierten und im gesamten Nordosten keinen einzigen. Doch langsam dämmert uns, dass das Virus auch unseren Plänen einen Strich durch die Rechnung machen könnte.
Doch zunächst wollen wir sehen, ob wir im von etwa 40% Muslimen bewohnten Guwahati trotzdem etwas vom dem Hindugott Krishna gewidmeten farbenfrohen Fest mitbekommen können. Doch außer ein paar Farbenverkäufern, vereinzelten Dekorationen und noch vereinsamten Bühnen ist nichts zu sehen. Als wir in eine Seitenstraße des als „Fancy Bazar“ bekannten Distrikts einbiegen, fällt uns jedoch eine kleine Menschenansammlung auf. Ein kleines Lagerfeuer soll wohl entfacht werden, jedoch tragen Männer auf Schnüre aufgefädelte Ringe aus getrocknetem Kuhdung statt Reisig heran. Frauen in prachtvollen roten Saris halten Schalen mit Opfergaben bereit, die sie den Flammen übergeben wollen. Ein dem ganzen scheinbar vorstehender Mann erklärt uns, alle Anwesenden wären miteinander verwandt. Ehe ein derartiges Ritual nicht abgeschlossen sei, dürfe man als gläubiger Hindu sein für diesen Tag anstehendes Fasten nicht beenden. Damit seine Familie schon bald die Festtagsspeisen verschmausen könne, seien sie früher als andere dran.
Wenige Minuten später brennt der Haufen, doch nur kurz haben die Umstehenden Zeit, einen Gesang anzustimmen, denn schon bald ist die ganze Straße von dickem beißenden Qualm gefüllt und jeder versucht, möglichst schnell noch seine rituellen Pflichten zu absolvieren, um sich anschließend in Sicherheit zu begeben.
Wir ziehen weiter zum bekanntesten Tempel der Stadt, dem Kamakhya. Die Legende besagt, dass er zu Ehren Satis, der Frau Shivas erbaut wurde, bzw. zu Ehren ihres Geschlechts. Als Sati trotz eines Verbots zu einem die Götter ehrenden Ritual ihres Vaters erschien, erboste sich dieser und verdammte nicht nur sie, sondern auch ihren nicht anwesenden Gemahl. Aus Wut und Verzweiflung soll Sati sich ins heilige Feuer gestürzt haben. Shiva, der für seine Barmherzigkeit und seine Fähigkeit, schlechtes Karma zu vertilgen, bekannt, aber auch der Gott der Zerstörung ist, verfiel daraufhin einem unbändigen Anfall von Rage, der erst durch die weise Tat Vishnus aufgehalten werden konnte, welcher den Leichnam Satis in 108 Stücken auf ganz Indien verteilte. Das Geschlecht Satis soll auf Guwahati gefallen sein und so feiert man im Tempel noch heute die Weiblichkeit und – tatsächlich – die Menstruation. Im Juni soll sich der nahe Fluss Brahmaputra gar rot färben und Hindus aus ganz Indien pilgern hierher, um sich einige Milliliter dieses heiligen Wassers abzufüllen. Eine fortschrittliche Message in einem Indien, dass seine uralten Bezüge zu Sexualität und Tantra leider weitgehend hinter sich gelassen hat.
Wir finden am Tempel vor allem betende oder feiernde Gläubige. Hier wurde sich anscheinend schon großzügig mit Farbe beworfen und auch unser langweiliges Äußeres wird schnell den Gepflogenheiten angepasst. In einem kleinen Nebenraum stimmen berauschte Männer zu wilden Rhythmen auf der Trommel lautstark Gesänge an und verteilen mit Cannabis versetztes Halva.


Doch ist Guwahati noch nicht, was wir im Nordosten Indiens gesucht haben. Deshalb fahren wir schon bald weiter nach Shillong. Hier gab es noch vor kurzem schwere Unruhen zwischen Moslems und Angehörigen des hiesigen meist christlichen Khasi-Stammes, in deren Verlauf mehrere Menschen starben. Jetzt scheint wieder Normalität eingekehrt zu sein, nur an den bewaffneten Soldaten auf den Straßen und den halbleeren Bars ist der Konflikt noch ablesbar. Wir bleiben eine Nacht, gucken uns einen furchtbaren lokalen Kinofilm zusammen mit einer durch Holi-Feierlichlichkeiten aufgeputschten Menge an und finden am Abend eine Kneipe, die es so auch in der Dresdner Neustadt geben könnte.
Doch trotzdem ist Shillong noch nicht wirklich, was wir im Nordosten Indiens gesucht haben.
Am nächsten Tag fahren wir weiter südlich und werden in Cherrapunjee das erste Mal direkt mit den Corona-Auswirkungen konfrontiert: das Hostel, das wir uns rausgesucht hatten, lehnt uns wegen Virus-Bedenken ab. Das ist nun wirklich nicht, was wir im Nordosten Indiens gesucht haben, also muss die Reise weitergehen.
Schnell ist glücklicherweise ein zweites Hostel gefunden, bei dem wir auch unseren halben Hausstand zwischenzeitlich einlagern dürfen. Uns steht ein kleiner aber anstrengender Abstieg in eines der herrlich grünen Täler Meghalayas bevor. Nach Nongriat geht es am nächsten Morgen, einem abgeschiedenen Dorf im Nirgendwo, welches für seine lebenden Wurzelbrücken bekannt ist, derer es ein gutes Dutzend im angrenzenden Dschungel gibt.

Nach unserer Ankunft steht schnell fest: das ist der Ort, den wir im Nordosten Indiens gesucht haben. Die Geräusche des Dschungels sind allgegenwärtig, als wir zu ersten Erkundungstouren aufbrechen. Meghalaya ist als der Bundesstaat der Wasserfälle bekannt. Die Spitzen der umliegenden Bergketten bestehen aus Kalkgestein, aus welchem sich besonders viele Quellen in die Täler ergießen. Das Wasser ist kristallklar, trinkbar und formt immer wieder die schönsten natürlichen Pools in den Fels. Wir sind hin und weg. Stundenlang können wir hier durch die Gegend laufen, die Wurzelbrücken überqueren und wie zwei Alices im Wunderland uns von den unzähligen bunten und handtellergroßen Schmetterlingen umflattern lassen.


An unserem letzten Tag – it happened to be a Sunday – machen wir uns zusammen mit Pablo, einem weiterem netten Berliner Jung, den wir hier kennenlernen dürfen, seiner herrlichen Gastgeberin Leenis und einer weiteren Familie auf den Weg zum Gottesdienst, welcher jeden Sonntag in einem anderen Dorf stattfindet. Dieses Mal ist die Wahl auf Tynrong gefallen, einem etwas größeren Dschungel-Dörfchen schlappe zweieinhalb Stunden Fußmarsch von Nongriat entfernt. Zu unserem Unglück geht es auch noch stolze 900 Höhenmeter hinauf. Auf dem Weg stoßen die Frauen gellende Laute aus (generell geht in den Stämmen des Nordostens viel Initiative von den Frauen aus, die Gemeinschaften sind maternalistisch geprägt), die von nah und fern erwidert werden und unsere Gruppe stetig wachsen lassen. Kurz bevor wir das Dorf des Geschehens betreten, wird noch einmal eine Rast eingelegt. Die Männer stecken sich noch eine Beedie (kurze indische Zigarette) an und wechseln ihr Tanktop gegen ein schickes Hemd, die Frauen tauschen Flip Flops gegen feines Schuhwerk. Schon von weitem sind die nochmals übers Megafon verstärkten Gesänge zu hören und tatsächlich stammen sie aus zwei Kirchen. An der ersten, der evangelischen gehen wir zügigen Schrittes vorbei, sie wirkt nicht stark besucht, die zweite, katholische hingegen ist fast bis auf den letzten Platz belegt. Untrainiert wie wir sind, wollen wir uns nur noch in die harten Kirchenbänke sinken lassen, aber offensichtlich ist hier gerade die Zeit des Stehens angebrochen. Endlich ist die Zeremonie aber überstanden und während Leenis und die anderen Frauen ihre Betelnüsse auspacken, bekommen wir süßen Tee und Kekse serviert, unsere zweite Mahlzeit nach den obligatorischen Magginudeln, die hier zum Frühstück mit einem Spiegelei verfeinert werden.
Pablo ist mittlerweile von einem jungen Dorfbewohner in ein anderes Haus eingeladen worden, der ihn und wenig später auch uns mit seinen Fremdsprachenkenntnissen überrascht und kurzerhand Reis mit Omelette zubereitet. Nach so viel Gastfreundlichkeit machen wir uns ganz beseelt schließlich auf den Rückweg.
Es ist herrlich hier, ein definitives Highlight unserer Indien-Erfahrungen und statt der geplanten 2 bleiben wir am Ende 4 Nächte. Aber selbst mitten im Dschungel gibt es Internet und täglich kommen einige neue Touristen an, die sich hier für die nächste Zeit einigeln wollen. Von einem israelischen Pärchen hören wir schließlich, dass Indien seine Landgrenze zu Myanmar bis auf Weiteres geschlossen hat. Unsere wunderschön ausgetüftelte Überland-Route ist uns versperrt. Spätestens jetzt wird klar: wir brauchen einen neuen Plan und zwar möglichst, bevor eine Ausreise noch schwieriger wird. Kurz überlegen wir, nach Myanmar zu fliegen, aber auch dort scheint die Situation unübersichtlich zu werden. In Facebook-Gruppen lesen wir von verunsicherten Touristen und widersprüchlich handelnden Behörden. Außerdem wäre das Land im Südosten Asiens wohl am schlechtesten auf eine ausbrechende Pandemie vorbereitet. Uns selber in Nongriat einzurichten klingt verlockend, aber wir haben das Gefühl, selbst hier fällt uns in spätestens 2 Wochen die Decke auf den Kopf. Schließlich steht unsere Entscheidung fest: wir fliegen nach Thailand, um wenigstens auf Kurs zu bleiben.
Wehmütig verabschieden wir uns vom Paradies und reisen ab.
Es soll, es muss jetzt schnell gehen. Kurz nur verweilen wir nochmals in Guwahati, um letzte Besorgungen zu machen und uns ein halbwegs offizielles Zertifikat zu besorgen, welches bestätigt, dass wir keine Symptome haben. Schon im Zug nach Kalkutta sitzend, buchen wir das Flugticket und finden uns 18 Stunden später am Flughafen wieder. So hatten wir uns unseren Abschied von Indien nicht vorgestellt…
In Bangkok angekommen, erschlägt uns erst einmal die Hitze. Henriette bemüht die schönen Vergleiche „Luft so dick wie Joghurt“ und „Ich fühle mich wie Apfelmus“. Doch die sonst so quirlige Hauptstadt bereitet uns einen entspannten Empfang. Die Straßen sind sauber und der Verkehr schlängelt sich fast lautlos durch die Straßen. Zu irgend etwas muss dieses scheiß Virus schließlich auch gut sein. Immerhin haben die berühmten Garküchen an den Straßenrändern noch auf und schnell merken wir, dass wir erneut in einem Street-Food-Paradies gelandet sind. Weil aber so gut wie alles andere auch hier geschlossen hat, haben wir genug Zeit, uns ein weiteres Vorgehen zu überlegen. Wollen wir uns nach einem neuen schönen Plätzchen umsehen, wo wir für längere Zeit bleiben könnten? Versuchen wir uns ein Gefährt zu besorgen, um unabhängiger und mehr „social distanced“ unterwegs sein zu können? Müssen wir uns am Ende doch in eine von Heikos Maschinen nach Hause setzen?
Es bleibt spannend, bleiben Sie dran.